Männer kriegen ’nen Herzinfarkt
Und Frauen? Leider auch. Sie sterben daran sogar häufiger als an Brustkrebs. Gendermedizin heißt der fachübergreifende Ansatz, bei dem Unterschiede von Mann und Frau hinsichtlich der Anfälligkeit für Krankheiten, deren Symptomatik und Therapie erforscht werden.
Text: Ingrid Kupczik, Fotos: Axel Kirchhof
„Frauen rechnen eher mit Brustkrebs, da ist das Bewusstsein sehr ausgeprägt“, sagt Elisabeth Unger, Ärztin in Weiterbildung in der Klinik für Kardiologie des Universitären Herz- und Gefäßzentrums. Das dürfte eine Folge der nachhaltigen Informationskampagnen und Früherkennungsangebote sein, „eine große Leistung der Präventionsarbeit der Kolleg:innen aus der Gynäkologie“, wie Unger betont. „Aber fest steht auch: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins bei Frauen.“ In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Herzinfarkt indes männlich.
Unterschiedliche Symptome
Die häufigste Ursache für einen Herzinfarkt ist eine Einengung der Herzkranzgefäße*. Die Symptomatik des Infarkts beim Mann zeigt sich prototypisch im Bild eines älteren Herrn, der mit schwerer Aktentasche in der Hand aus dem Restaurant in die Winterkälte tritt, die andere Hand auf der Brust, schmerzverzerrtes Gesicht. „So wurde es auch noch vor einigen Jahren im Studium vermittelt“, berichtet Unger. Das Beschwerdebild der Frauen sei dagegen vielschichtiger: „Neben Brustschmerzen geben sie genauso häufig Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen an – Krankheitszeichen, die man eher mit einer Magen-Darm-Grippe in Verbindung bringen würde.“ Die Betroffenen unterschätzen womöglich ihr Risiko für einen Herzinfarkt – aber auch die Untersuchenden sind nicht frei von Fehlwahrnehmungen. „Wenn eine Patientin Bauchschmerzen oder diffuses Unwohlsein angibt, werden diese Beschwerden vielleicht zunächst anders eingeschätzt und abgeklärt.“



Ignoranz des Geschlechts
„Bisher sind Frauen in klinischen Studien zu kardiovaskulären Erkrankungen noch deutlich unterrepräsentiert“, konstatiert Elisabeth Unger, und Prof. Dr. Götz Thomalla, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie im UKE, bestätigt diesen Befund für die Schlaganfallforschung: „Für neuere Studien werden zu Recht Maßnahmen für eine gleichmäßig verteilte Rekrutierung von Männern und Frauen gefordert.“ Die Verstoffwechslung mancher Medikamente unterscheide sich bei Mann und Frau schon allein durch Körpermasse, Gewicht und Größe. „Man darf spekulieren, ob es wirklich in allen Fällen sinnvoll und adäquat ist, wenn für Männer und Frauen immer gleich dosiert wird“, sagt Prof. Thomalla.
Frauenspezifische Ursachen
„Laut Analysen profitieren die Männer und Frauen von den meisten Therapien.“ Grundsätzlich bestehen nach Auskunft des Experten hinsichtlich der Symptome und der Therapie keine Unterschiede, wenn es um die klassischen Ursachen oder Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Vorhofflimmern geht. Aber es gibt frauenspezifische Ursachen, etwa Schlaganfälle in der Schwangerschaft oder rund um die Geburt, die im Kontext anderer gesundheitlicher Probleme wie beispielsweise Thrombosen auftreten, jedoch zum Glück sehr selten sind. Genderspezifisch* ist beim Schlaganfall der Risikofaktor Rauchen. Früher waren die Männer deutlich häufiger betroffen, mittlerweile hat sich das Verhältnis ungünstig nivelliert. Auch die Einnahme der Antibabypille und die Hormonersatztherapie in der Menopause können das Schlaganfallrisiko erhöhen.
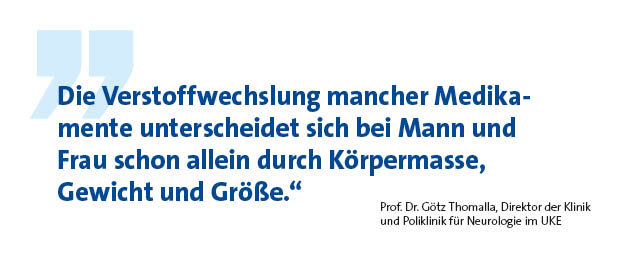
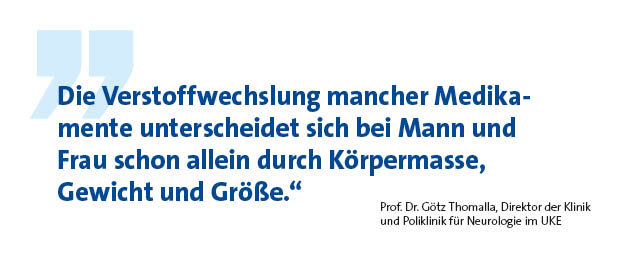

Fest steht laut Thomalla: „Bei den klaren, schweren, eindeutigen Schlaganfällen macht es keinen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau betroffen ist.“ Lähmungen und Sprachstörungen seien gleich. Doch das Spektrum verschiedener Schlaganfälle ist breit, und Frauen haben offenbar häufiger atypische Formen, die sich nicht anhand schwerer Symptome äußern, sondern mit Schwindel, Übelkeit, Bewusstseinsstörungen einhergehen – „und deshalb auch öfter fehldiagnostiziert werden“. So ergab eine Studie zur Einschätzung von Schlaganfällen durch den Rettungsdienst, dass bei Frauen diese schon mal als Migräne oder Kopfschmerzen fehlgedeutet wurden. „Große Studien bestätigen, dass Frauen, die einen Schlaganfall erlitten, deutlich häufiger als Männer initial eine andere Verdachtsdiagnose hatten.“
Genderspezifisch ist offenbar auch die Genesung: „Untersuchungen zeigen, dass Frauen sich schlechter von den Folgen eines Schlaganfalls erholen als Männer, da sie unter anderem weniger soziale Unterstützung erfahren. Eine erschütternde Interpretation dieser Daten legt nahe, dass Frauen ihre Männer besser unterstützen als umgekehrt“, berichtet Prof. Thomalla.
Eine gendersensible Medizin bietet noch viele offene Fragen und Ansatzpunkte: Wie kann man mehr Frauen in klinische Studien einbeziehen? Warum werden, wenn Tierversuche für die Therapieentwicklung erforderlich sind, bisher keine weiblichen Versuchstiere berücksichtigt? „Gendermedizin ist der erste und vielleicht wichtigste Schritt zu einer personalisierten Medizin“, darin sind sich Kardiologin Elisabeth Unger und Neurologe Götz Thomalla einig.

