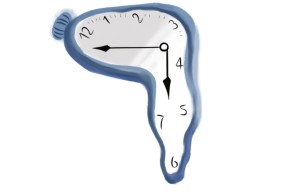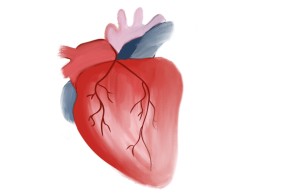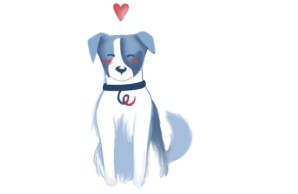Fragen und Antworten:
Mein Kurs durch die Transplantation: Das Herz
Liebe Patient:innen und Angehörige,
um Ihnen die Orientierung in den "Häufig gestellten Fragen" zu erleichtern, sind die Fragen grob in idealtypische Etappen geordnet. Je nachdem wo Sie sich im Prozess der Transplantation befinden, können Sie unten in den "FAQs" gezielt die für Sie relevanten Fragen ansteuern.
Ihr Kurs teilt sich in fünf aufeinander folgende Etappen:
1.Etappe: Diagnose und Persönliche Orientierung
-
1.1) Plötzlich ist alles anders...
Plötzlich ist alles anders...
Herzerkrankungen können sich schleichend entwickeln oder plötzlich auftreten. Ein gesundes Herz schlägt während eines menschlichen Lebens etwa 3 Milliarden Mal und pumpt dabei rund 200 Millionen Liter Blut (zum Vergleich: so viel Wasser befindet sich in etwa in der Binnenalster). Obwohl das Herz normalerweise ein Leben lang zuverlässig arbeitet, kann es durch verschiedene Erkrankungen so stark geschädigt werden, dass seine Pumpleistung nicht mehr ausreicht.
Ursachen für ein fortschreitendes Herzversagen können unter anderem sein:
- Eine koronare Herzkrankheit (z. B. Herzinfarkt)
- Erkrankungen der Herzklappen
- eine Herzmuskelentzündung
- vererbbare Herzmuskelerkrankungen (genetische Kardiomyopathien)
Am Ende einer schweren Herzerkrankung steht die fortgeschrittene Herzschwäche („Advanced Heart Failure“). Bei betroffenen Patient:innen ist die Herzfunktion trotz optimaler medikamentöser und interventioneller Therapie so stark eingeschränkt, dass sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität deutlich reduziert sind. Häufig sind die Beschwerden so ausgeprägt, dass selbst alltägliche Dinge wie Spazierengehen oder das Erledigen des Haushalts kaum noch möglich sind. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod.
Eine Herztransplantation ist für diese Patient:innen häufig die einzige verbleibende Therapieoption.
Vergabe von Spenderorganen
Die für eine Herztransplantation benötigten Spenderorgane werden über die Eurotransplant-Warteliste vergeben. Da die Zahl der verfügbaren Spenderherzen begrenzt ist, wird vor der Aufnahme auf die Warteliste sorgfältig geprüft, ob eine Transplantation im individuellen Fall die beste Therapieoption darstellt. Voraussetzung ist neben dem Vorliegen einer fortgeschrittenen Herzerkrankung das Nichtvorhandensein von Gründen, die gegen eine Herztransplantation sprechen (sogenannte "Kontraindikationen" wie z.B. Tumorerkrankungen, aktiver Substanzenabusus etc.).
Ebenso ist ein ansonsten guter Allgemeinzustand ohne wesentliche Erkrankung anderer Organe eine wichtige Voraussetzung, um die Erfolgsaussichten der Transplantation und der anschließenden lebenslangen Therapie mit immunsuppressiven Medikamenten weiter zu erhöhen.
Chancen und Herausforderungen einer Herztransplantation
Eine erfolgreiche Herztransplantation kann die Lebenserwartung und Lebensqualität erheblich verbessern. Die meisten Patient:innen sind nach der Operation wieder deutlich leistungsfähiger, können ein weitgehend normales Leben führen und profitieren von einer verbesserten Herz-Kreislauf-Funktion.
Dennoch erfordert eine Transplantation eine engmaschige ärztliche Betreuung und stellt neue Herausforderungen an die Patient:innen:
- Die regelmäßige Einnahme immunsuppressiver Medikamente ist essenziell, um eine Abstoßung des Spenderorgans zu verhindern.
- Die Wahrnehmung regelmäßiger Kontrolluntersuchungen, um eventuelle Nebenwirkungen der Medikamente (wie z.B. Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Nierenschädigung) und/oder Folgen einer Immunsuppression (wie z.B. ein erhöhtes Risiko für eine Infektion oder eine Tumorerkrankung) frühzeitig zu erkennen.
Über all diese Aspekte und weitere Fragen zur Herztransplantation informieren wir Sie ausführlich in den folgenden FAQs.
-
1.2) Fragen über Fragen - Woher bekomme ich jetzt Informationen?
Fragen über Fragen - woher bekomme ich jetzt Informationen?
Der beste erste Ansprechpartner für das Thema Transplantation ist zunächst Ihr Kardiologe oder Ihre Kardiologin und später Ihr betreuendes Ärzteteam am UKE.
Im Internet finden sich zahlreiche Informationen zur Herztransplantation, jedoch oft in unterschiedlicher Qualität. Bleiben Sie bei Ihrer eigenen Recherche auf unbekannten Seiten zunächst kritisch und achten Sie auf die Quelle, Aktualität und die Autoren bzw. Herausgeber der Seite.
Falls Unsicherheiten bestehen, zögern Sie nicht, Ihren Kardiologen oder Ihre Kardiologin um Rat zu fragen.
Gute und verlässliche Informationen findet man z.B. auf folgenden Seiten:
-
1.3) Und mein Umfeld?
Und mein Umfeld?
Neben den Gesprächen mit den behandelnden Ärzt:innen sind vor allem auch der Austausch mit dem sozialen Umfeld – beispielsweise mit Angehörigen, Freund:innen, Bekannten oder Kolleg:innen – eine wertvolle Unterstützung für den Genesungsprozess.
Auch der Kontakt mit Gleichbetroffenen, etwa in Patientenverbänden oder Selbsthilfegruppen, kann eine wertvolle Informationsquelle sein und eine emotionale Entlastung bieten.
Da sich Patient:innen insbesondere zu Beginn des gesamten Transplantationsprozesses oft in einer Ausnahmesituation befinden und die Fülle an neuen Informationen als überwältigend empfinden können, ist es hilfreich, Angehörige oder vertraute Personen frühzeitig in den Behandlungsprozess und die ärztlichen Gespräche einzubeziehen. Dies hat mehrere Vorteile:
- Betroffene erhalten bessere Unterstützung durch ihr Umfeld.
- Angehörige können aktiv Fragen stellen und sich ebenfalls informieren.
- Missverständnisse werden vermieden, da mehr Personen in den Informationsfluss eingebunden sind.
Eine frühzeitige Einbindung des sozialen Umfelds kann zudem helfen, mögliche Krisensituationen zu vermeiden, die durch ungenaue Kommunikation oder fehlerhafte Weitergabe von Informationen entstehen könnten. Dabei sollte jedoch sorgfältig abgewogen werden, wer vertrauensvoll in diesen Prozess einbezogen werden soll.
Da eine schwere Erkrankung nicht selten zu Veränderungen im sozialen Umfeld führt, kann das offene Gespräch über die Erkrankung, Behandlungsoptionen und den Krankheitsverlauf dazu beitragen, Gefühlen von Isolation und Einsamkeit vorzubeugen.
-
1.4) Wie nehme ich Kontakt zum Transplantationszentrum auf?
Wenn für Sie eine Herztransplantation in Frage kommt oder Sie weitere Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit in unserer Ambulanz für Herzinsuffizienz, Herztransplantationen und Kunstherzsysteme vorstellen.
Für eine schnelle Terminvereinbarung erreichen Sie uns unter:
Telefon:+49 (0) 40 7410 - 54371
E-Mail: herzinsuffizienz@uke.deAuch Ihre Kardiologin oder Ihr Kardiologe kann sich jederzeit direkt an unser Zentrum wenden. Die Kontaktmöglichkeiten für Ärzt:innen finden Sie auf der Homepage des UTC im Abschnitt Für zuweisende Ärzt:innen
2.Etappe: Zum ersten Mal am UKE und die Evaluation
-
2.1) Zum ersten Mal am UKE - Wo finde ich die Herzinsuffizienz- und transplantationsambulanz?
Zum ersten Mal am UKE
Der UKE-Campus in Hamburg-Eppendorf ist fast so groß wie ein eigener Stadtteil – kein Wunder, denn hier arbeiten rund 15.000 Mitarbeiter:innen. Wenn Sie das UKE zum ersten Mal besuchen, kann die Orientierung zwischen den vielen Gebäuden eine Herausforderung sein.
Wir helfen Ihnen, den schnellsten Weg zu uns zu finden.Unsere Herzinsuffizienz- und transplantationsambulanz befindet sich im Gebäude N21, direkt hinter dem großen UKE-Hauptgebäude O10. Vor dem Gebäude gibt es Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Vom Haupteingang des UKE-Geländes an der Martinistraße oder vom Parkhaus des UKE aus beträgt der Fußweg zur Ambulanz noch ca. 400 m.
So finden Sie uns schnell und einfach:
Nutzen Sie den Online-Wegweiser des UKE. Geben Sie unter "Ziel wählen" einfach die Gebäudenummer N21 ein.
Hier können Sie außerdem einen ausdruckbaren Lageplan des UKE mit allen Gebäuden herunterladen.
Zusätzliche Orientierung vor Ort: Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes O10 befindet sich ein Informationstresen, an dem Sie gerne nachfragen können.Weitere Hinweise zur Anfahrt, einen Bereichsfinder sowie weitere Informationen finden Sie außerdem auf der Homepage des UKE oder am unteren Ende dieser Seite.
Wichtiger Hinweis für Ihren Termin:
Bitte denken Sie daran: Für das Erstgespräch benötigen wir einen Überweisungsschein Ihres Kardiologen oder Ihrer Kardiologin (mit Kreuz bei § 116b).
-
2.2) Was passiert im ersten Arztgespräch? Und werde ich gleich untersucht?
Was passiert im ersten Arztgespräch? Und werde ich gleich untersucht?
Das erste Gespräch dient vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen und der umfassenden Information. Wir erläutern Ihnen ausführlich das Thema Herztransplantation, einschließlich:
- der Voraussetzungen für eine Transplantation
- der erforderlichen Voruntersuchungen
- der Wartezeit und des Ablauf der Transplantation
- des Krankenhausaufenthalts und der Nachsorge
- der Chancen und Risiken der Transplantation.
Gleichzeitig möchten wir mehr über Sie und Ihre Krankengeschichte erfahren. Bitte bringen Sie alle Arztbriefe zu Ihrer Herzerkrankung sowie zu möglichen Begleiterkrankungen mit.
Erfolgt bereits eine Untersuchung?
Ja, in der Regel umfasst Ihr erster Termin:
- eine Blutentnahme
- ein Herzultraschall (Echokardiographie)
- ein EKG
- ein detailliertes Anamnesegespräch.
Basierend auf diesem Gespräch und den vorliegenden Unterlagen erstellen wir eine erste Einschätzung Ihrer Erkrankung und beraten Sie individuell zu den nächsten Schritten.
Ihre Fragen sind wichtig!
Diese Situation ist für Sie neu und möglicherweise mit vielen Fragen verbunden. Bringen Sie diese gerne mit – wir nehmen uns Zeit für Sie und beantworten Ihre Fragen ausführlich.
-
2.3) Was ist die "Evaluation" und was passiert da?
Was ist die „Evaluation“ und was passiert da?
Eine Herztransplantation ist ein schwerwiegender Eingriff mit großen Chancen, aber auch erheblichen Risiken. Daher ist es essenziell, dass Patient:innen vor einer Transplantation gründlich untersucht werden, um sicherzustellen, dass keine schwerwiegenden Begleiterkrankungen oder andere Risikofaktoren vorliegen, die den Erfolg der Transplantation gefährden könnten.
- Einige Erkrankungen müssen vor einer Transplantation behandelt werden (z. B. ein entzündeter Zahn oder starkes Übergewicht).
- Andere Erkrankungen können eine Transplantation sogar ausschließen (z. B. eine aktive Krebserkrankung).
Der gesamte Prozess dieser medizinischen Beurteilung wird als „Evaluation“ bezeichnet.
Welche Untersuchungen sind erforderlich?
Im Rahmen der Evaluation werden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, um die körperliche Eignung für eine Herztransplantation festzustellen. Dazu gehören u.a.:
- Rechtsherzkatheteruntersuchung
- Koronarangiografie
- Spiroergometrie
- CT-Untersuchung von Brustkorb und Bauch
- Ultraschalluntersuchungen der großen Blutgefäße
- Krebsvorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt/Urologen und beim Hautarzt
- Ambulante zahnärztliche Kontrolle
- ggf. eine Magen- und Darmspiegelung
- Vielzahl an Blutuntersuchungen
- Transplantationspsychologische Untersuchung.
Welche dieser Untersuchungen Sie ambulant selbst in die Wege leiten können und welche in unserem Transplantationszentrum im UKE durchgeführt werden, besprechen wir gemeinsam mit Ihnen. So stellen wir sicher, dass der Evaluationsprozess für Sie so effizient und reibungslos wie möglich abläuft. Falls gewünscht oder notwendig, können diese Untersuchungen auch während eines stationären Aufenthalts im UKE durchgeführt werden.
Interdisziplinäre Bewertung und Entscheidung
Abschließend erfolgt eine interdisziplinäre Besprechung durch unser Transplantationsteam. Dieses setzt sich aus Expert:innen verschiedener Fachrichtungen zusammen: Kardiologie, Herzchirurgie, Immunologie, Transplantationspsychologie, Transplantationskoordination und Pflege.
Am Ende der Evaluation steht idealerweise die Aufnahme auf die Eurotransplant-Warteliste. Sollte eine Transplantation nicht möglich oder nicht die beste Therapieoption sein, werden gemeinsam alternative Behandlungsmöglichkeiten besprochen.
Unterstützung durch unsere Transplantationskoordinatorin
Unser Zentrum verfügt über eine spezialisierte Transplantationskoordinatorin, die Ihnen während des gesamten Prozesses als feste Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Sie arbeitet eng mit den behandelnden Ärzt:innen zusammen und koordiniert die Evaluationsuntersuchungen.
Wir empfehlen die stationäre Durchführung der Evaluationsuntersuchungen. Dadurch kann der Evaluationsprozess beschleunigt werden kann, sodass Patient:innen schneller auf die Warteliste aufgenommen werden können, ohne lange auf externe Facharzttermine warten zu müssen.
Die umfassenden Untersuchungen „aus einer Hand“ helfen uns darüber hinaus, die individuellen Chancen und Risiken einer Transplantation fundiert zu bewerten.
Mit der Evaluation stellen wir sicher, dass jede Transplantation die bestmöglichen Erfolgschancen hat – für ein längeres und besseres Leben mit einem neuen Herzen.
-
2.4) Warum gibt es in der Evaluation auch ein "Psychologisches Konsil"?
Warum gibt es in der Evaluation auch ein "Psychologisches Konsil"?
Im Rahmen der Evaluation für eine Herz- oder Lungentransplantation werden immer auch transplantationspsychologische Untersuchungen durchgeführt. Diese dienen dazu, mögliche psychische Belastungen bei Betroffenen und Angehörigen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf gezielte Unterstützung zu koordinieren.
In einigen Fällen ist eine psychologische Untersuchung auch erforderlich, um sicherzustellen, dass Patient:innen nach der Transplantation die notwendige Zuverlässigkeit bei folgenden Aspekten aufbringen:
- Regelmäßige Medikamenteneinnahme
- Wahrnehmung von Kontrollterminen
- Allgemeines gesundheitsbewusstes Verhalten
- Aktives und rechtzeitige Melden bei Beschwerden (z.B. Luftnot, Fieber, Durchfälle).
Diese sogenannte „Adhärenz“ ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Transplantation.
-
2.5) Wie komme ich auf die Warteliste für ein Organangebot?
Wie komme ich auf die Warteliste für ein Organangebot?
Wenn die abschließenden Ergebnisse Ihrer Evaluation zeigen, dass eine Herztransplantation für Sie medizinisch sinnvoll und möglich ist, erfolgt die Aufnahme auf die Warteliste für ein Spenderherz. Dies geschieht nach einer sorgfältigen medizinischen Prüfung und mehreren formellen Schritten.
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Warteliste:
- Fortgeschrittene Herzerkrankung
Bevor eine Herztransplantation die optimale Behandlungsoption darstellt, müssen alle anderen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein. - Allgemeine körperliche Verfassung
Sie müssen gesundheitlich stabil genug sein, um die große Operation zu überstehen und langfristig mit dem neuen Herzen und der dazugehörigen immunsuppressiven Medikation gut leben zu können. - Zustimmung zur Transplantation
Sie müssen der Aufnahme auf die Warteliste zustimmen und klar dazu entschieden sein, dass Sie im Falle eines passenden Organangebots bereit sind, die Transplantation durchführen zu lassen.
Entscheidung durch die Transplantationskonferenz
Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme auf die Warteliste trifft die Transplantationskonferenz. Dieses interdisziplinäre Expertengremium besteht aus:
- Kardiolog:innen
- Herzchirurg:innen
- Vertreter:in des ärztlichen Direktors
- Psychotherapeut:innen
- weiteren Fachärzt:innen.
Was passiert nach der Aufnahme auf die Warteliste?
Nach einer positiven Entscheidung der Transplantationskonferenz werden Sie auf die aktive Warteliste unseres Transplantationszentrums aufgenommen und bei Eurotransplant gemeldet. Ab diesem Zeitpunkt könnten Sie theoretisch jederzeit ein Organangebot erhalten.
Die tatsächliche Wartezeit variiert jedoch und hängt von mehreren Faktoren ab:
- Blutgruppe
- Gewebeverträglichkeit
- Dringlichkeit
- Verfügbarkeit passender Spenderorgane
Betreuung während der Wartezeit
Sobald Sie auf der Warteliste stehen, werden Sie von unserer Transplantationskoordinatorin sowie der Herzinsuffizienz- und Transplantationsambulanz betreut. Sie erhalten:
- Eine schriftliche Bestätigung Ihrer Listung bei Eurotransplant
- Einen Transplantationspass im praktischen Scheckkartenformat mit wichtigen Informationen, darunter die Kontaktdaten unseres Zentrums.
Ein wichtiger Schritt – wir begleiten Sie
Die Aufnahme auf die Warteliste ist ein bedeutender Schritt, sowohl medizinisch als auch persönlich. Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Seite, beantwortet Ihre Fragen und bereitet Sie bestmöglich auf die Transplantation vor.
- Fortgeschrittene Herzerkrankung
3.Etappe: Auf der Warteliste
-
3.1) Frisch auf der Warteliste
Frisch auf der Warteliste
Mit der Aufnahme auf die Warteliste beginnt Ihre Wartezeit auf ein Spenderherz. Die Organvergabe erfolgt nach den Kriterien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht und wird zentral über die Vermittlungsstelle Eurotransplant organisiert.
Eurotransplant ist eine gemeinnützige Organisation, die die Verteilung aller Spenderorgane in Deutschland, den Benelux-Ländern, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn koordiniert. Durch diesen internationalen Austausch wird sichergestellt, dass gespendete Organe effizient und passgenau an Patient:innen vermittelt werden.
Als Transplantationszentrum arbeiten wir während des gesamten Evaluations- und Transplantationsprozesses eng mit Eurotransplant und der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) zusammen.
Auf der Warteliste: T- und HU-Status
Patient:innen auf der Warteliste erhalten je nach Dringlichkeit eine unterschiedliche Einstufung:
- T-Status (= "transplantierbar")
- Sie sind auf der aktiven Warteliste und warten zu Hause auf ein passendes Spenderherz.
- Da die Wartezeit variieren kann, sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen erforderlich.
- HU-Status ("high urgency" = Hochdringlichkeit)
- Dieser Status gilt für Patient:innen, die aufgrund ihres Herzversagens unmittelbar lebensbedroht sind.
- Sie müssen während der gesamten Wartezeit im Krankenhaus bleiben und werden auf der Herztransplantationsstation (Heart Failure Unit) betreut.
- Dafür steht Ihnen ein komfortableres Zimmer zur Verfügung, das mehr Privatsphäre, Platz und Komfort bietet als ein übliches Patientenzimmer.
- Die Wartezeit im HU-Status ist in der Regel deutlich kürzer als im T-Status.
Wie lange dauert die Wartezeit?
Die genaue Wartezeit auf ein Spenderherz lässt sich nicht vorhersagen. Sie hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:
- Blutgruppe
- Gewebeverträglichkeit
- Dringlichkeit und Zustand anderer Patient:innen auf der Warteliste.
Weitere Informationen zur Organvermittlung finden Sie in Frage Nr. 4.1
- T-Status (= "transplantierbar")
-
3.2) Muss ich auch auf der Warteliste regelmäßig zu Untersuchungen?
Muss ich auch auf der Warteliste regelmäßig zu Untersuchungen?
Viele der Untersuchungen, die im Rahmen der Evaluation durchgeführt wurden, behalten über einen längeren Zeitraum ihre Gültigkeit. Einige Untersuchungen müssen jedoch bei einer längeren Wartezeit regelmäßig wiederholt werden.
Ein Beispiel dafür ist die Krebsvorsorge, die weiterhin jährlich beim Frauenarzt oder Urologen erfolgen muss.
Welche Untersuchungen in welchem Zeitabstand erforderlich sind, besprechen wir individuell bei jedem Termin in der Transplantationsambulanz.
In Einzelfällen können die ambulanten Verlaufskontrollen auch durch das zuweisende Zentrum oder Ihre ambulante Kardiologin bzw. Ihren ambulanten Kardiologen durchgeführt werden. Eine Vorstellung in unserem Transplantationszentrum sollte jedoch mindestens einmal pro Jahr erfolgen.
-
3.3) Krankenhausaufenthalte und Reisen "auf der Warteliste" - was muss ich beachten?
Krankenhausaufenthalte und Reisen "auf der Warteliste" - was muss ich beachten?
Sollten Sie aufgrund einer anderen Erkrankung stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, kann eine Herztransplantation in dieser Zeit in der Regel nicht erfolgen.
Daher ist es wichtig, dass Sie oder die behandelnden Ärzt:innen in einem solchen Fall unsere Transplantationskoordination umgehend informieren. Ihr Status auf der Warteliste kann dann vorübergehend pausiert werden.
Ohne eine rechtzeitige Mitteilung könnte es passieren, dass wir für Sie ein passendes Organangebot von Eurotransplant zunächst annehmen, es dann jedoch wieder ablehnen müssen, weil eine Transplantation nicht möglich ist. Dies würde wertvolle Zeit kosten, und das Organ könnte möglicherweise nicht mehr rechtzeitig einem anderen wartenden Patienten oder einer anderen Patientin zugeteilt werden – was angesichts des großen Mangels an Spenderorganen sehr bedauerlich wäre.
Was gilt für Reisen?
Wenn Sie eine Reise oder einen längeren Aufenthalt außerhalb der Nähe Ihres betreuenden Transplantationszentrums planen (mehr als ca. 2–3 Stunden Autofahrt entfernt), bitten wir Sie, sich vorab mit unserer Transplantationskoordination in Verbindung zu setzen. So können wir gemeinsam besprechen, wie Ihre Wartezeit während dieser Zeit bestmöglich organisiert werden kann.
-
3.4) Wenn das Warten auf den Geist geht....
Wenn das Warten auf den Geist geht...
Eine der größten Herausforderungen für Transplantations-Kandidat:innen ist die ungewisse Wartezeit. Dies betrifft sowohl die Dauer der Wartezeit auf ein passendes Organangebot als auch die notwendige ständige Erreichbarkeit.
Um Sie bestmöglich in dieser Phase zu unterstützen, bietet unser Zentrum auf Wunsch psychologische Begleitung an.
Im Rahmen dieser Unterstützung können begleitende psychologische Gespräche stattfinden – sowohl ambulant als auch stationär. Dabei erarbeiten wir gemeinsam Strategien für:
- Den Umgang mit einer möglicherweise langen Wartezeit
- Emotionale Krisen und Belastungen
- Veränderungen des Gesundheitszustands
- Anpassungen im sozialen Umfeld
- Die eigene Rolle und Selbstwahrnehmung.
Unsere psychologische Unterstützung hilft Ihnen, diese herausfordernde Zeit bestmöglich zu bewältigen.
-
3.5) Mein Familie - die Angehörigen warten mit...
Meine Familie - die Angehörigen warten mit...
Eine Organtransplantation betrifft nicht nur die Patient:innen selbst, sondern hat oft auch Auswirkungen auf das soziale Umfeld. Durch stationäre Aufenthalte, eingeschränkte Leistungsfähigkeit oder Sorgen um die Gesundheit kann die Situation auch für Angehörige belastend sein.
Deshalb bietet unser Transplantationszentrum auch für Angehörige psychologische Unterstützung an.
-
3.6) Arbeit und Beruf auf der Warteliste
Arbeit und Beruf auf der Warteliste
Ob Patient:innen während der Wartezeit auf ein Spenderorgan weiterhin arbeiten können, hängt individuell vom Gesundheitszustand und der jeweiligen beruflichen Tätigkeit ab. Grundsätzlich ist eine berufliche Tätigkeit während der Wartezeit möglich, sofern der Gesundheitszustand es erlaubt.
Sozialrechtliche Beratung und Unterstützung
Bei sozialrechtlichen Fragen zur beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang mit der Erkrankung – etwa zu möglicher Berentung oder Wiedereingliederung – kann während eines stationären Aufenthalts eine Beratung durch unseren Sozialdienst in Anspruch genommen werden.
Sind Sie weiterhin berufstätig, empfiehlt sich ein frühzeitiger Kontakt mit dem oder der Schwerbehindertenbeauftragten oder dem Betriebsrat, falls in Ihrem Unternehmen vorhanden.
Nur wer seine gesundheitlichen Bedürfnisse am Arbeitsplatz klar kommuniziert, kann die nötige Unterstützung des Arbeitgebers einfordern.
Zusätzliche Beratung und Information bieten auch die jeweiligen regionalen Integrationsämter sowie Integrationsfachdienste.
Grundlegende erste Informationen zum Thema Teilhabe für Menschen mit chronischen Krankheiten bzw. Schwerbehinderung finden Sie auch unter www.einfach-teilhaben.de , einer Info-Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
4.Etappe: Die Transplantation
-
4.1 Durch wen und nach welchen Kriterien erfolgt die Verteilung von Spenderorganen?
Durch wen und nach welchen Kriterien erfolgt die Verteilung von Spenderorganen?
Rechtlicher Rahmen der Organspende und Transplantation:
In Deutschland erfolgen Organspende und Transplantation innerhalb eines klar definierten rechtlichen Rahmens. Das Transplantations-gesetz regelt die Zusammenarbeit und Strukturen der beteiligten Institutionen. Dabei sind die Bereiche Organspende, Organvermittlung und Organübertragung bewusst strikt voneinander getrennt, um maximale Transparenz und Neutralität zu gewährleisten.
Aufgabenteilung der beteiligten Institutionen:
Drei zentrale Akteure sind für die verschiedenen Schritte der Organspende und Transplantation verantwortlich:
- Transplantationszentrum (UKE)
- Medizinische Begleitung und Betreuung der Patient:innen
- Verwaltung der Wartelisten
- Durchführung der eigentlichen Transplantation.
- Eurotransplant (internationale Vermittlungsstelle)
- Koordination und Vermittlung postmortaler Spenderorgane nach festgelegten Kriterien.
- Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)
- Koordination der Organspende in Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern
- Logistische Abwicklung einer Organspende.
Eurotransplant – Die internationale Vermittlungsstelle:
Die gemeinnützige Stiftung Eurotransplant vereint acht europäische Länder: Deutschland, Belgien, Niederlande, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Ungarn, Slowenien
Eurotransplant ist die zentrale Vermittlungsstelle für Spenderorgane in diesen Ländern. Alle Patient:innen, die auf ein oder mehrere Spenderorgane warten, sind dort registriert. Die Organe werden nach festgelegten Kriterien zugewiesen – je nach Organ stehen dabei Erfolgsaussicht und Dringlichkeit im Vordergrund.
Die Rolle der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO):
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist die bundesweite Koordinierungsstelle für Organangebote in Deutschland. Bei einer postmortalen Organspende übernimmt sie den gesamten Ablauf und sorgt dafür, dass eine Organspende überall und jederzeit möglich ist.
Dazu beschäftigt die DSO erfahrene Koordinator:innen, die für die praktische und logistische Abwicklung der Organspende zuständig sind. Sie arbeiten eng mit der Transplantationskoordination im UKE zusammen, die rund um die Uhr – 24 Stunden an 7 Tagen die Woche – erreichbar ist, um eine reibungslose Durchführung der Organspende zu gewährleisten.
- Transplantationszentrum (UKE)
-
4.2) Plötzlich klingelt das Telefon....
Plötzlich klingelt das Telefon...
Sobald ein passendes Spenderorgan für Sie verfügbar ist, rufen wir Sie an – unabhängig davon, ob es Tag oder Nacht ist. Im Hintergrund haben wir das Organangebot bereits sorgfältig geprüft und sichergestellt, dass es nach bestimmten Kriterien das bestmögliche Organ für Sie ist.
Wichtig: Erreichbarkeit sicherstellen:
- Die Benachrichtigung erfolgt häufig nachts. Bitte stellen Sie sicher, dass wir Sie jederzeit erreichen können.
- Halten Sie Ihr Telefon in Hörweite, auch nachts.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre bei uns hinterlegten Rufnummern aktuell sind.
- Geben Sie Ersatznummern an, z. B. von Angehörigen oder Ihrer Arbeitsstelle, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Vorbereitung auf den Krankenhausaufenthalt:
Um im Ernstfall schnell reagieren zu können, empfiehlt es sich, eine bereits gepackte Tasche mit den wichtigsten Dingen für den Krankenhausaufenthalt bereitzuhalten.
Ablauf nach dem Anruf:
- Wir fragen Sie nach Ihrem aktuellen Befinden und ob es gesundheitliche Einschränkungen gibt.
- Sie bestätigen, dass Sie weiterhin zur Transplantation bereit sind.
Beachten Sie zu diesem Thema auch die folgende Frage 4.3.
-
4.3) Wie komme ich jetzt ins Krankenhaus?
Wie komme ich jetzt ins Krankenhaus?
In der Regel werden Patient:innen bei einem Organangebot von einem Krankenwagen zu Hause abgeholt.
Falls Ihr Gesundheitszustand es zulässt, ist die eigene Anreise zum Transplantationszentrum auch mit dem eigenen PKW oder einem Taxi möglich.
Wichtiger Hinweis:
Falls Sie mit dem eigenen PKW kommen, lassen Sie sich unbedingt fahren. Aufgrund der Aufregung sollten Sie nicht selbst am Steuer sitzen.Bei selbstständiger Anreise zum UKE:
- Steuern Sie auf dem UKE-Gelände direkt die Zentrale Notaufnahme an.
- Dort werden Sie auf die Transplantationsstation weitergeleitet.
- Wichtig: Weisen Sie bei Ihrer Ankunft in der Notaufnahme deutlich auf die bevorstehende Transplantation und die dringliche Aufnahme hin.
Die Mitarbeiter:innen der Notaufnahme sind in der Regel bereits von unserer Transplantationskoordination über Ihr Eintreffen informiert und erwarten Sie. Hinweise zur Anfahrt zur Notaufnahme finden Sie hier .
Unterstützung durch die Transplantationskoordination:
Bei Problemen oder Fragen zur Anreise steht Ihnen unsere Transplantationskoordination gerne unter
+49 (0) 40 7410 - 54777 zur Verfügung.Bitte melden Sie sich dort auch unverzüglich, falls es auf Ihrem Weg zu Verzögerungen oder Schwierigkeiten kommt.
-
4.4) Was passiert direkt vor der OP mit mir im Krankenhaus?
Was passiert direkt vor der OP mit mir im Krankenhaus?
Nach Ihrer Ankunft in der Klinik werden Sie zunächst auf der Normalstation aufgenommen. Dort erfolgt eine erneute Blutabnahme, um Ihre aktuellen Laborwerte zu bestimmen und mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen.
Prüfung des Spenderorgans und Vorbereitung der Narkose:
- Im weiteren Verlauf werden Sie von den Narkoseärzt:innen begleitet und überwacht.
- Währenddessen überprüft ein spezialisiertes Ärzteteam aus unserem Haus vor Ort das Spenderorgan erneut, um sicherzustellen, dass es gesund und optimal für Sie geeignet ist.
- Die Narkose wird erst eingeleitet, wenn das Spenderorgan endgültig akzeptiert wurde.
Was passiert, wenn die Transplantation abgesagt wird?
Die sorgfältige Prüfung des Spenderorgans bedeutet jedoch auch, dass die Operation im letzten Moment abgesagt werden kann. Falls medizinische Gründe dagegensprechen, steht Ihre Gesundheit an erster Stelle, und die Transplantation wird nicht durchgeführt.
Glücklicherweise kommt dies nur selten vor.
-
4.5) Die Operation
Die Operation
Bei der Herztransplantation wird der Brustkorb eröffnet und das erkrankte Herz durch das Spenderorgan ersetzt. Während des Eingriffs wird der Patient an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Diese übernimmt vorübergehend die Funktion von Herz und Lunge und sorgt dafür, dass der Körper weiterhin mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird.
So läuft die Transplantation:
- Das Spenderherz wird eingesetzt und mit den großen Blutgefäßen verbunden.
- Anschließend wird das neue Herz wieder zum Schlagen gebracht.
- Der Patient wird langsam von der Herz-Lungen-Maschine entwöhnt, sodass das neue Herz die volle Funktion übernehmen kann.
Nach der Operation:
- Direkt nach der Transplantation erfolgt eine mindestens 48-stündige Überwachung auf der Intensivstation. Dort werden Kreislauf und Organfunktion engmaschig kontrolliert.
- Wenn alles stabil verläuft, wird der Patient schrittweise aus der Narkose geweckt.
- Bei stabilen Kreislaufverhältnissen erfolgt die Verlegung auf die Transplantationsstation (Heart Failure Unit).
Dauer des Klinikaufenthalts und Rehabilitation:
Verläuft die Transplantation ohne Komplikationen, beträgt der Klinikaufenthalt in der Regel einige Wochen. In dieser Zeit beginnt die erste Phase der Rehabilitation, in der sich der Körper an das neue Herz anpasst.
-
4.6) Muss ich nach der Operation auf die Intensivstation?
Muß ich nach der Operation auf die Intensivstation?
Ja, nach der Herztransplantation werden Sie für einige Tage auf der Intensivstation überwacht. Dort kann die Funktion Ihres neuen Herzens rund um die Uhr kontrolliert werden, um einen stabilen Verlauf sicherzustellen.
-
4.7) Die ersten Tage nach der OP - Als Patient:in auf der Heart Failure Unit
Die ersten Tage nach der OP - als Patient:in auf der Heart Failure Unit
Nach einer Herztransplantation verbringen die meisten Patient:innen zunächst einige Tage auf der Intensivstation, wo Kreislauf, Organfunktion und allgemeiner Zustand engmaschig überwacht werden. Sobald sich Ihr Zustand stabilisiert hat, erfolgt die Verlegung auf die Heart Failure Unit (HFU) – eine spezialisierte Station für Herzpatient:innen. Hier stehen Ihnen rund um die Uhr erfahrene Ärzt:innen und ein speziell geschultes Pflegeteam zur Verfügung.
Jeder Tag nach der Operation bringt Sie ein Stück weiter in Richtung Selbstständigkeit. Auch wenn es anfangs noch anstrengend sein kann, ist es wichtig, dass Sie frühzeitig wieder aufstehen und sich bewegen. Unser Team aus Ärzt:innen, Pflegekräften und Physiotherapeut:innen unterstützt Sie dabei aktiv.
In den ersten Tagen nach der Transplantation kümmern wir uns besonders um:
- Ihre Herzfunktion: Engmaschige Überwachung von Kreislauf, Blutdruck und Herzleistung.
- Ihren Flüssigkeitshaushalt: Kontrolle von Trinkmenge, Urinausscheidung und Drainagen, um das Herz nicht unnötig zu belasten.
- Die Wundversorgung: Ihre Operationswunde wird regelmäßig kontrolliert und versorgt.
- Schmerzlinderung: Wir sorgen dafür, dass Sie möglichst schmerzfrei sind.
- Ihre Mobilität: Physiotherapeut:innen helfen Ihnen, so früh wie möglich wieder aufzustehen und sich zu bewegen.
Zusätzlich:
- Tägliches Wiegen: Ihr Gewicht wird täglich kontrolliert, um Wassereinlagerungen oder Kreislaufprobleme frühzeitig zu erkennen.
- Visiten: Bei den täglichen Arztgesprächen berichten Sie, wie es Ihnen geht, und können Fragen stellen.
- Erste Schulungen: Bereits auf der Station erhalten Sie wichtige Informationen zum Leben mit dem neuen Herzen, insbesondere zur Medikamenteneinnahme (Immunsuppressiva), Ernährung und körperlichen Aktivität.
Nach etwa zwei bis vier Wochen auf der Heart Failure Unit erfolgt die Verlegung in eine Rehabilitationsklinik, wo Sie weiter stabilisiert und auf den Alltag mit dem neuen Herzen vorbereitet werden. Unser Ziel ist es, Sie Schritt für Schritt auf ein sicheres und gesundes Leben mit Ihrem neuen Herzen vorzubereiten. Bei Fragen oder Unsicherheiten sind wir jederzeit für Sie da!
-
4.8) Wie geht´s mit mir weiter - in die Reha oder nach Hause?
Wie geht’s mit mir weiter – in die Reha oder nach Hause?
Nach einer Herztransplantation ist eine Rehabilitation ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in den Alltag. Die lange Krankheitsphase vor der Transplantation sowie die Operation selbst können die körperliche Leistungsfähigkeit erheblich einschränken. In der Reha wird Ihre körperliche Belastbarkeit schrittweise wieder aufgebaut, sodass Sie sicher und gestärkt in Ihr neues Leben mit dem transplantierten Herzen starten können.
Neben gezieltem Herz-Kreislauf-Training erhalten Sie Schulungen zur Medikamenteneinnahme, Ernährung und allgemeinen Lebensführung mit dem neuen Organ. Auch die ärztliche Betreuung bleibt eng abgestimmt mit unserem Transplantationszentrum, um eine optimale Nachsorge zu gewährleisten.
Um den erforderlichen Reha-Antrag bei der Krankenkasse oder Rentenversicherung kümmert sich der Sozialdienst des UKE in enger Absprache mit Ihnen. Die Verlegung erfolgt in der Regel direkt von der Station in die Rehabilitationsklinik.
Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit der Müritz-Klinik im mecklenburgischen Klink und der Mühlenbergklinik in der Holsteinischen Schweiz (Bad Malente) und mit der Knappschafts-Klinik Bad Driburg zusammen, die auf die Betreuung von Herztransplantierten spezialisiert sind. Dort werden Sie von erfahrenen Kardiolog:innen und Therapeut:innen begleitet, um Ihre Gesundheit weiter zu stabilisieren und Ihre Selbstständigkeit im Alltag zurückzugewinnen.
-
4.9) Psychologische Begleitung im Krankenhaus
Psychologische Begleitung im Krankenhaus
Erfahrene Transplantationspsycholog:innen sind fester Bestandteil Ihres interdisziplinären Behandlungsteams, wenn Sie sich im UKE befinden. Dank dieser interprofessionellen Zusammenarbeit werden sie auch hinsichtlich Ihrer psychischen Stabilität bestmöglich unterstützt.
Sollte auch nach Ihrer Entlassung eine psychotherapeutische Unterstützung gewünscht oder notwendig sein, unterstützen wir Sie gerne bei der Suche nach einer ambulanten psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeit.
5. Etappe: Im neuen Leben / Nachsorge
-
5.1) Wieder zuhause!
Wieder zuhause!
Nach der stationären Rehabilitation kehren Sie nach Hause zurück. Wie gut Sie sich fühlen, hängt häufig davon ab, wie fit Sie bereits vor der Transplantation waren. In vielen Fällen werden Sie jedoch eine deutliche Verbesserung Ihrer körperlichen Verfassung spüren.
Jetzt ist es besonders wichtig, dass Sie sich selbstständig und gewissenhaft um Ihr neues Herz kümmern. Dazu gehören:
- Zuverlässige Einnahme Ihrer Medikamente
- Regelmäßige Nachsorgetermine in der Transplantationsambulanz
- Körperliches Training zur Förderung der Fitness
- Gesunde Ernährung zur Unterstützung Ihrer Genesung
- Beachtung der Hygienevorgaben, um Infektionen zu vermeiden.
Genauere Informationen zu diesen Themen finden Sie in den Antworten auf die folgenden Fragen.
-
5.2) Sport? Physiotherapie? Wie werde ich wieder aktiv?
Sport? Physiotherapie? Wie werde ich wieder aktiv?“
Ein wesentlicher Faktor für einen langfristig erfolgreichen Verlauf ist der Wiederaufbau Ihrer Muskulatur und das Schritt-für-Schritt-Kräftigen Ihres Körpers. Je nachdem, wie fit Sie vor der Transplantation waren, kann dies unterschiedlich lange dauern.
Falls erforderlich, kann anfangs eine ambulante Physiotherapie unterstützend verordnet werden. Ihr Ziel sollte jedoch sein, möglichst bald regelmäßig Kraft- und Ausdauersport im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu betreiben.
Es gibt sogar eine eigene Sportgemeinschaft für Transplantierte und Dialysepatienten: TransDia Sport Deutschland e.V. Das Angebot umfasst Sportarten für alle Altersgruppen, von Aktivitäten mit geringer körperlicher Belastung wie Darts oder Pétanque bis hin zu anspruchsvolleren Disziplinen wie Radfahren und Schwimmen.
Es werden sogar deutsche, europäische und Weltmeisterschaften ausgetragen. Diese setzen ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Sport und Bewegung für Transplantierte sowie für die gesellschaftliche Relevanz der Organspende.
-
5.3) Immunsuppression - was bedeutet das für mich?
Immunsuppression – was bedeutet das für mich?“
Ein Spenderorgan erfordert eine lebenslange Einnahme von Medikamenten, denn ohne Immunsuppression wäre eine Transplantation nicht möglich. Ihr Immunsystem erkennt das transplantierte Herz als fremd und würde es ohne entsprechende Medikamente sofort abstoßen.
Daher müssen Sie ab dem Moment der Transplantation täglich und lebenslang Immunsuppressiva einnehmen. Diese Medikamente dämpfen das Immunsystem, um eine Abstoßung des Organs zu verhindern. In der Regel müssen Sie mehrere Tabletten morgens und abends einnehmen.
Um keine Einnahme zu vergessen, nutzen viele Patient:innen:
- Einen Medikamentenwecker,
- ihr Smartphone als Erinnerung,
- eine Medikamentendose.
⚠️ Wichtig:
Lassen Sie es nicht dazu kommen, dass Ihre Tabletten aufgebraucht sind, bevor Sie Nachschub haben. Achten Sie darauf, rechtzeitig Folgerezepte zu erhalten und auf Reisen immer genügend Vorrat mitzunehmen.Nebenwirkungen und Schutzmaßnahmen:
Immunsuppressiva können verschiedene Nebenwirkungen haben. Besonders in den ersten Monaten treten häufig folgende Beschwerden auf:
- Händezittern
- Haarausfall
- Erhöhte Infektanfälligkeit.
Um sich bestmöglich zu schützen, sollten Sie:
- sich regelmäßig impfen lassen,
- Händedesinfektion konsequent anwenden,
- gegebenenfalls eine Maske tragen.
Ernährung und Krebsvorsorge:
Auch über Lebensmittel können Krankheiten übertragen werden. Daher gilt:
❌ Kein rohes Fleisch oder Fisch
❌ Keine rohen Eier
Nach einer Transplantation besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen. Daher sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen essenziell. Vorsorge bedeutet auch:- Konsequenter Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor, um Hautkrebs vorzubeugen.
Langfristige Nebenwirkungen und regelmäßige Kontrolle:
Immunsuppressiva können auch langfristige Nebenwirkungen haben, darunter:
- Bluthochdruck
- Veränderungen des Blutbilds
- Nierenschädigung
- Diabetes
- Osteoporose
- Grauer Star.
Denken Sie daran: Eine Herztransplantation kann nur durch eine anschließende und lebenslange Immunsuppression erfolgreich verlaufen. Ihre konsequente Medikamenteneinnahme und regelmäßigen Nachsorgetermine sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Transplantation.
-
5.4) Nachsorgeuntersuchungen am Transplantationszentrum
Nachsorgeuntersuchungen am Transplantationszentrum
Die regelmäßige Nachsorge ist entscheidend, um die Funktion Ihres neuen Herzens und die Verträglichkeit der Medikamente zu überwachen.
In den ersten Wochen nach der Transplantation müssen Sie wöchentlich zur Transplantationsambulanz (Gebäude N21 am UKE) kommen. Mit der Zeit werden die Abstände schrittweise verlängert, bis nach etwa einem Jahr nur noch alle drei Monate ein Kontrolltermin erforderlich ist.
Bei den sogenannten "3er-Terminen" umfasst die Untersuchung:
- Arztgespräch
- Blutentnahme (inkl. Messung des Immunsuppressiva-Spiegels)
- Herzultraschall (Echokardiographie)
- EKG.
Weitere Vorsorgeuntersuchungen:
Da die Immunsuppressiva das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöhen können (z. B. Infektionen oder Krebserkrankungen), sollten Sie zusätzlich die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen bei externen Fachärzt:innen wahrnehmen.
Das kann zwar mit organisatorischem Aufwand verbunden sein, doch dieser Einsatz lohnt sich:
Er ermöglicht Ihnen ein (fast) normales Leben mit hoher Lebensqualität – inklusive Sport und Reisen. -
5.5) Meine Ansprechpartner am Transplantationszentrum: Die Transplantations-Nurses
Meine Ansprechpartner am Transplantationszentrum: Die Transplantations-Nurses
Speziell ausgebildete Transplantationsfachpflegekräfte (sogenannte „Transplantations -Nurses“ oder kurz „Tx-Nurses“) sind fester Bestandteil Ihres stationären und ambulanten Behandlungsteams. Sie stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner:innen bei allen Fragen rund um Ihre Erkrankung und die Transplantation zur Seite.
Bereits bei Ihrer Erstvorstellung in unserer Ambulanz lernen Sie die Transplantations-Nurse im Bereich der Herztransplantation kennen. Sie bleibt Ihre feste Ansprechperson, mit der Sie in engem Kontakt stehen – für alle Fragen rund um Ihr neues Leben mit einem Spenderherzen.
-
5.6.) Was verändert sich in meinem Alltag?
Was verändert sich in meinem Alltag?“
Ihr Leben nach der Herztransplantation – Chancen und Verantwortung
Das Ziel einer Herztransplantation ist es, Ihnen die bestmögliche Lebensqualität in allen Bereichen zu ermöglichen – sei es in der Familie, im Beruf, beim Sport oder auf Reisen.
Damit einher geht jedoch eine verantwortungsvolle Selbstfürsorge. Besonders wichtig sind:
- Zuverlässige Einnahme Ihrer Medikamente
- Regelmäßige Arztbesuche und Kontrolluntersuchungen
- Konsequente Einhaltung von Hygieneempfehlungen.
Diese Disziplin ist entscheidend, um Ihre Gesundheit langfristig zu schützen und Ihnen ein aktives, erfülltes Leben mit Ihrem neuen Herzen zu ermöglichen.
-
5.7) Welche Ärzt:innen brauche ich? Kann ich meinen Hausarzt/Hausärztin behalten?
Welche Ärzt:innen brauche ich? Kann ich meinen Hausarzt/Hausärztin behalten?“
Auch nach Ihrer Herztransplantation bleiben Sie in regelmäßiger Nachsorge bei uns. In der Transplantationsambulanz können wir uns jedoch ausschließlich um transplantationsspezifische Aspekte Ihrer Gesundheit kümmern.
Daher ist es wichtig, dass Sie weiterhin Ihre gewohnte hausärztliche Versorgung in Anspruch nehmen.
Wir arbeiten selbstverständlich gern eng mit Ihren niedergelassenen Ärzt:innen zusammen, um Ihre medizinische Betreuung bestmöglich zu koordinieren.
-
5.8) Kann ich nach meiner Transplantation auch Organe spenden?
Kann ich nach meiner Transplantation auch Organe spenden?“
Die Spende eines Organs ist ein wertvolles Geschenk, das Anerkennung und Dankbarkeit verdient. Nach einer erfolgreichen Herztransplantation können auch Sie dazu beitragen, das Bewusstsein für Organspende zu stärken.
Indem Sie aus eigener Erfahrung berichten, helfen Sie anderen, sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Ihr Engagement kann dazu beitragen, dass mehr Menschen eine bewusste Entscheidung für oder gegen eine Organspende treffen und diese in einem Organspendeausweis oder im Organspenderegister dokumentieren.
Auch Sie können Organspender:in sein!
Auch nach einer Herztransplantation können Sie unter bestimmten Voraussetzungen selbst Organe spenden. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten und treffen Sie Ihre persönliche Entscheidung.
-
5.9) Wie kann ich Danke sagen? Ist ein Treffen mit der Spenderfamilie möglich?
Wie kann ich Danke sagen? Ist ein Treffen mit der Spenderfamilie möglich?
In Deutschland ist es nicht möglich, die Spenderfamilie persönlich zu treffen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben es nicht, die Identität des Organspenders oder der Organspenderin, seiner oder ihrer Familie oder des Organempfängers oder der Organempfängerin offenzulegen.
Für viele Empfänger:innen eines Spenderorgans bleibt dennoch der tiefe Wunsch, „Danke“ zu sagen. Schließlich ist die Spende eines lebensrettenden Organs ein Geschenk von unschätzbarem Wert.
Ein möglicher Weg, Dankbarkeit auszudrücken, ist ein anonymer Brief an die Angehörigen des Organspenders oder der Organspenderin. Viele Spenderfamilien empfinden einen solchen Brief als besonders wertvoll und emotional berührend – und oft als Bestätigung, mit ihrer Entscheidung das Richtige getan zu haben.
Ob Sie einen Dankesbrief schreiben möchten, bleibt Ihre persönliche Entscheidung.
Falls Sie einen Dankesbrief schreiben wollen, muss dieser anonym verfasst werden – Hinweise hierzu finden Sie unter diesem Link .
Bei persönlichen Fragen zum Thema Dankesbrief können Sie sich auch direkt an die Deutsche Stiftung Organtransplantation unter der E-Mail-Adresse dankesbrief@dso.de wenden.
-
5.10) Sexualität, Kinderwunsch und Schwangerschaft
Sexualität, Kinderwunsch und Schwangerschaft
Nach einer Herztransplantation gibt es grundsätzlich keine Einschränkungen im Intimleben. Vertrauen Sie auf Ihren Körper und entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, was sich für Sie richtig anfühlt.
Wichtige Hinweise zur Empfängnisverhütung
- Achten Sie auf einen zuverlässigen Empfängnisschutz.
- Die Antibabypille kann mit Immunsuppressiva interagieren und bietet daher keinen zuverlässigen Schutz vor einer Schwangerschaft.
- Lassen Sie sich von Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt zu alternativen Verhütungsmethoden beraten.
Kinderwunsch nach der Transplantation
- Wenn Sie einen Kinderwunsch haben, sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem behandelnden Ärzteteam.
- In manchen Fällen kann bei Männern eine Anpassung der immunsuppressiven Medikation erforderlich sein.
- Herztransplantierte Frauen können grundsätzlich schwanger werden. Eine Schwangerschaft sollte jedoch gut geplant und eng ärztlich begleitet werden.
-
5.11) Sozialrechtliche Fragen rund um die Herztransplantation
Sozialrechtliche Fragen rund um die Herztransplantation
Neben den medizinischen Aspekten ergeben sich nach einer Herztransplantation oft viele sozialrechtliche Fragen, darunter:
- Bin ich nun als schwerbehindert eingestuft?
- Welchen Grad der Behinderung (GdB) habe ich?
- Kann oder muss ich nach der Transplantation wieder arbeiten gehen?
Diese Themen sind komplex und lassen sich nicht in wenigen Worten beantworten. Sie erfordern oft detaillierte Erklärungen, die individuell auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind.
Informationsquellen & Unterstützung
- Detaillierte Informationen finden Sie in verschiedenen Patientenratgebern, die auch für Herztransplantierte relevant sind.
- Herunterladbare Broschüren zum Sozialrecht stehen Ihnen beispielsweise auf der Website www.leben-mit-transplantation.de zur Verfügung.
- Unser Transplantationszentrum bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen auch zu sozialrechtlichen Fragen im Rahmen der Patientenseminare an.( Hier finden Sie einen Überblick über die Patientenseminare des UTC in der Vergangenheit.)
-
5.12) Darf ich als Transplantierte:r eigentlich Haustiere haben?
Darf ich als Transplantierte:r eigentlich Haustiere haben?
Auch nach einer Organtransplantation bleiben Haustiere weiterhin ein wichtiger Teil der Familie. Sie müssen nicht abgegeben werden. Der positive psychologische Effekt des Zusammenlebens mit Haustieren ist wissenschaftlich belegt und sollte nicht unterschätzt werden.
Jedoch besteht für immunsupprimierte Menschen ein erhöhtes Risiko für Zoonosen – also Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können. Daher ist es wichtig, sich über mögliche Gesundheitsrisiken zu informieren und entsprechende hygienische Maßnahmen konsequent einzuhalten.
Wichtige Verhaltensregeln für den sicheren Umgang mit Haustieren:
- Keine fremden oder streunenden Tiere anfassen oder streicheln.
- Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen:
Impfstatus auf dem aktuellen Stand halten.
Regelmäßige Wurmkuren durchführen (auch für Wohnungskatzen). - Erkrankungen des Tieres sofort tierärztlich abklären.
- Haustiere nicht im eigenen Bett schlafen lassen.
- Hunde regelmäßig pflegen und auf Flöhe und Zecken untersuchen.
- Nach jedem Kontakt mit Tieren gründlich die Hände waschen.
- Kein direkter Kontakt mit Tierspeichel:
Tiere nicht küssen oder sich ablecken lassen.
Tierspeichel kann gefährliche Infektionen wie Hautinfektionen, Blutvergiftungen oder Knochen- und Hirnhautentzündungen auslösen. - Katzen- und Hundebisse sofort ärztlich versorgen:
Schon kleine Verletzungen erfordern oft eine antibiotische Behandlung. - Eigener Impfstatus überprüfen:
Besonders die Tetanus-Impfung sollte aktuell sein.
Hygiene und Futteraufbewahrung:
- Tierdecken regelmäßig bei mindestens 60°C waschen.
- Futter- und Trinknäpfe täglich reinigen; Trinkwasser täglich erneuern.
- Tierfutter getrennt von menschlichen Lebensmitteln lagern.
- Besonders bei Frischfleisch auf das Haltbarkeitsdatum achten.
- Bei Symptomen wie Fieber oder Durchfall den Arzt/die Ärztin informieren, dass Sie ein Haustier haben – so kann eine gezielte Erregerdiagnostik erfolgen.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Käfige, Ställe, Terrarien und Katzentoiletten:
Reinigung nicht durch immunsupprimierte Personen durchführen. Falls das nicht möglich ist, sollten Handschuhe und Mundschutz getragen werden.Spezifische Risiken durch bestimmte Tierarten:
Katzen (Toxoplasmose-Gefahr):
Der Erreger Toxoplasma gondii wird über Katzenkot ausgeschieden – auch bei Wohnungskatzen.
Eine Infektion kann zu schweren Komplikationen führen, insbesondere, wenn sie erstmals nach der Transplantation auftritt.
Ein Bluttest kann zeigen, ob Sie bereits eine Toxoplasmose-Infektion durchgemacht haben. Falls ja, verläuft eine erneute Infektion meist milder.Kaninchen (Parasitengefahr):
In freier Natur meiden Kaninchen ihren eigenen Kotablageplatz – in einem Stall ist das jedoch nicht möglich. Kaninchen setzen sehr häufig Kot ab, wodurch sich Parasiten und Ungeziefer (z. B. Milben) leicht vermehren können.
Der Stall sollte deshalb stets sauber gehalten und mit saugfähigem Streu ausgelegt werden.Vögel: Vögel können Psittakose übertragen, die sogenannte Papageienkrankheit. Der Erreger ist das Bakterium Chlamydia psittaci und wird über den Kot der Vögel ausgeschieden. Er kann beim Menschen Lungenentzündung hervorrufen. Vogelkäfige bedürfen besonderer Hygiene; die Reinigungsintervalle sollten kurz gehalten werden, die Bodenschale möglichst mit heißem Wasser säubern. Nicht im gleichen Raum schlafen, in dem sich der Vogelkäfig befindet.
Reptilien: Das Substrat in Terrarien regelmäßig ersetzen. Futter und Trinkwasser täglich erneuern und die Näpfe und Schalen gründlich reinigen (viele Reptilien setzen ihren Kot bevorzugt in Wasser ab!). Auch gute Durchlüftung und UV-Bestrahlung helfen, die Erregerzahl im Terrarium gering zu halten.